Start
Multimedia-EssaysOstdeutsch sein. Was heißt das? Gedanken zu 30 Jahren im geeinten Land - Teil des Multimedia-Projekts "Wir Ostdeutsche"
Ein Multimedia-Projekt von Das Erste, RBB und MDR
Digitale Umsetzung: Philipp von Nathusius
Vorwort
In kurze Essays gefasst fließen in die Antworten Erinnerungen und Erfahrungen ein an die Zeit der DDR, die Zeit der Wende und an die Jahre danach; schöne wie hässliche. Doch der Blick geht nicht nur zurück. Die Autorinnen und Autoren bewerten das Hier und Jetzt im geeinten Deutschland, manche wagen einen Blick in die Zukunft. Es sind zutiefst persönliche Statements, subjektive Meinungen. Sie stehen stellvertretend dafür, dass es die eine ostdeutsche Sicht auf die Wiedervereinigung nicht gibt.
Conrad Clemens
Marcel Dettmann
Marcel Dettmann"Ostdeutsch sein: Zwischen Zusammenhalt und Perspektivlosigkeit"
Ines Geipel
Sven Gábor Jánszky
Patrice G. Poutrus
Josa Mania-Schlegel
Sookee

Die Doku im Ersten: "Wir Ostdeutsche"
Was heißt es, ostdeutsch zu sein nach 30 Jahren im geeinten Land?
"Wir Ostdeutsche" - Multimediales Datendossier
Die Entwicklung von 1990 bis heute. Ost und West im statistischen Vergleich.
Wie die D-Mark in den Osten kam
Die Geschichte des größten Geldtransportes in der Geschichte. Eine Multimedia-Reportage.
"Geschichte im Ersten"
Geschichte erleben, Geschehenes erfahren, Zusammenhänge verstehen: Alle Dokus aus der Reihe "Geschichte im Ersten".
Letzte Generation Ost
Letzte Generation Ost von Conrad Clemens
Letzte Generation Ost von Conrad Clemens

Inside my DNA - Kendrick Lamar
Nicht so einfach, über eine Zeit zu sprechen, die einen geprägt hat: Schnell ist man dabei, persönlich Angenehmes zu verklären, Unangenehmes wegzulassen, Prägendes zu relativieren. Und schon gibt man der Geschichte einen ganz persönlichen Anstrich.
Wissenschaftlich gesehen werde ich der „Dritten Generation Ost“ zugeordnet. 3GO ist keine Boygroup oder Terrorgruppe und auch nicht der nächste Mobilfunkstandard. Die Zugehörigkeit ergibt sich dadurch, dass man im politischen Schlussakt eines Staates geboren wurde. Man vermutet bei den von 1975 bis 1985 in der DDR-Geborenen unter anderem eine besondere „Transformationskompetenz“.
Im Januar 1983 in Schönebeck an der Elbe zur Welt gekommen, ist der real existierende Sozialismus für mich in erster Linie erzählte Familiengeschichte: Meine Mutter, nicht die Schlechteste ihrer Klasse, durfte als selbstbewusste Christin in der Oberlausitz kein Abitur machen. Mein Vater wurde aus demselben Grund erst Buchhändler und kam als Wehrdienstverweigerer dann nur über Bildungsumwege zum Theologiestudium in Jena. Ein Onkel war bei den Protesten des Prager Frühlings dabei, ein anderer in der ersten frei gewählten Volkskammer.
Ich selbst sollte in der ersten Klasse nicht Pionier werden – als einziger in der Klasse! Diese (unfreiwillige!) Auflehnung hat das System anscheinend endgültig ins Wanken gebracht – zwei Monate später war’s vorbei.
Viele DDR-Geschichten. Emotional alles sehr aufgeladen
"Gibt es eine einheitliche Erzählung nach der Friedlichen Revolution? Kann es sie geben?" Conrad Clemens
"Gibt es eine einheitliche Erzählung nach der Friedlichen Revolution? Kann es sie geben?" Conrad Clemens

Viele DDR-Geschichten. Emotional alles sehr aufgeladen
Hinter den Zahlen und Entwicklungen stehen unendlich viele Geschichten, schreckliche Tragödien, herrliche Komödien. Aber gibt es eine einheitliche Erzählung nach der Friedlichen Revolution? Kann es sie geben? Vermutlich bin ich nicht der Einzige, der sich mit einer Antwort darauf schwertut. Genauso, wie es zahlreichen Landsleuten dies- und jenseits von Vogtland, Harz und Elbe schwerfällt, sich in die geschichtliche Ausnahmesituation und die darin abgebrochenen und begonnenen Lebenswege hineinzuversetzen.
Weder erscheint mir vor diesem Hintergrund der Versuch der Wiederbelebung einer ungebrochenen ostdeutschen Identität erfolgversprechend, noch kann ein verharmlosender Blick auf die DDR gutgehen, die einige als vom westdeutschen Kapitalismus erledigten Versuch der gesellschaftlichen Solidarität mystifizieren.
Prägt uns die Ost-DNA noch heute?
Prägt uns die Ost-DNA heute noch?
Prägt uns die Ost-DNA heute noch?

Was mir dabei immer wieder durch den Kopf geht: Wo finden wir „Wendekinder“ uns in diesen Entwicklungen wieder? Prägt uns die Ost-DNA noch heute? Hat der 37-jährige „Ossi“ wirklich etwas, das der 37-jährige „Wessi“, dessen Eltern in den neunziger Jahren nach Dresden gekommen sind, nicht hat? Ist diese Kategorisierung heute für uns überhaupt noch relevant? Wird eine mögliche Ost-DNA weitergegeben oder gibt es eine letzte Generation Ost?
Ich selbst habe in den 30 Jahren nach 1990 ziemlich rastlos in Berlin, Frankfurt/Oder, Dresden und auch lange im Ausland gelebt. Für mich verbindet sich eigenes Erleben mit dem Blick in die Zukunft: Meine Ost-Geschichte ist ein Baustein dafür. Sie ist aber nicht mein Schicksal, weder im Positiven noch im Negativen.
Wir sollten unseren Blick nicht auf die Geschehnisse von 1990 verengen und dieses Jahr zum konstitutiven Zeitpunkt für jedwede Transformation verklären. Sicher, die Wiedervereinigung war eine Zäsur für viele und vieles. Aber gesellschaftliche Wandelprozesse haben auch schon davor ihren Lauf genommen: Die Zahl nicht-ehelicher Bindungen stieg auch schon zur DDR-Zeit, während die Geburtenrate nach unten ging. Der Drang nach demokratischer Beteiligung und Partizipation fanden ja gerade in der Friedlichen Revolution von 1989/90 und auch in den anderen friedlichen Umbrüchen im Ostblock ihren Höhepunkt – und er ist auch heute in zahlreichen Ländern noch oder wieder hochaktuell. Oder schauen wir auf die Umwelt- und Klimaproblematik: erneuerbare Energie, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit sind offenkundig keine Erfindung des Einigungsvertrages, sicher auch nicht der Grünen (den Begriff der „Nachhaltigkeit“ hat der sächsische Oberberghauptmann von Carlowitz bereits vor mehr als 300 Jahren beschrieben, eine Umweltbewegung gab es schon in der DDR (und den ersten FCKW-freien Kühlschrank entwickelte die Ost-Firma Foron!).
Wir haben etwas zu erzählen, das andere so nicht erzählen können
"Wir haben etwas zu erzählen, das andere so nicht erzählen können" Conrad Clemens
"Wir haben etwas zu erzählen, das andere so nicht erzählen können" Conrad Clemens

Und hier kommen wir ins Spiel: die Erstklässler aus Frankfurt (Oder), Zittau, Bernburg oder Rerik in den letzten Monaten der DDR. Und unsere Transformationserfahrungen. Ob wir aus den Erfahrungen „wandlungskompetenter“ hervorgegangen sind? Bleibt abzuwarten.
Manch einer hat die Friedliche Revolution nicht verkraftet, aber die allermeisten haben es gut überlebt und einen unschätzbaren Erkenntnisgewinn erlebt: Wir haben etwas zu erzählen, das andere so nicht erzählen können. Es ist wichtig, dass wir uns um eine deutliche Stimme bemühen und dass sie auch gehört wird.
Es ist wichtig, dass wir die gewonnenen Freiheiten als Chancen nutzen und nicht im Rückblick auf Unfreiheit verharren. Ich freue mich, wenn jede Erzählung aus den Tagen, als unsere Eltern mit uns neue Wege einschlugen, zu mehr Selbstbewusstsein und zur Freude an Beteiligung, an Führung mit Verantwortung und an Veränderung wächst. //
Der Autor
Zwischen Zusammenhalt und Perspektivlosigkeit
Essay Ostdeutsch sein: Zwischen Zusammenhalt und Perspektivlosigkeit von Marcel Dettmann
Essay Ostdeutsch sein: Zwischen Zusammenhalt und Perspektivlosigkeit von Marcel Dettmann

Denn eigentlich war die damalige Religion, dass man mit Menschen zusammenlebte und zusammenarbeitete und gemeinsam eine gute Zeit hatte. Gleichzeitig gab es natürlich schon immer Randgruppen und Freigeister, die sich nicht einfügen wollten. Als Kind habe ich diese Unterschiede nicht verstanden. Mir wurde ja auch beigebracht, sich in eine Gruppe zu fügen, sei eine ganz tolle Sache. Ich hab‘s versucht, aber merkte gleichzeitig, dass mir nicht klar war, was eigentlich meine Perspektive in diesem Land – in der DDR – sein sollte. Das Bewusstsein darüber, sich überlegen zu müssen, wo der eigene Platz ist, wuchs in dieser Zeit.
Und dann kam die Wende – und alles war auf einmal komplett anders.
Aber es heißt nicht, auf einmal wäre alles möglich gewesen. Das Gefühl glich eher einer Überforderung: Oh Gott, was ist jetzt los?
Die neu gewonnene Freiheit war erstmal auch eine Form der Perspektivlosigkeit. Ich war noch sehr jung, vor meinen Augen änderte sich alles – zum Beispiel das Schulsystem. Schule war so gar nicht meins, Stillsitzen und mir Dinge in den Kopf prügeln konnte ich nie. Mit der Wende wurde das alles auf den Kopf gestellt. Man musste sich sofort – so wie es einem zu DDR-Zeiten erzählt worden war – für eine Gruppe entscheiden, um dazu zugehören: rechts oder links.
Das habe ich nie verstanden und auch damals nicht gekonnt. Ich geriet zum Außenseiter – ein Freak, ein Alien, der Typ, den man immer gefragt hat: was ist denn jetzt deine Meinung?
Plattenspieler oder Mofa?
"Dann setzte eine Zeit ein, die es bestimmt auch an anderen Orten gab, aber sicher fühlte sie sich nirgends so an, wie in Berlin"
"Dann setzte eine Zeit ein, die es bestimmt auch an anderen Orten gab, aber sicher fühlte sie sich nirgends so an, wie in Berlin"

Plattenspieler oder Mofa?
Heute glaube ich: Wäre das alles nicht passiert – Wende, Nachwendezeit – ich wäre vermutlich Polizist geworden und würde Judo für Kinder unterrichten. Was man damals halt irgendwie so gemacht hat.
Erst mit der Wende fing ich an, mich für Musik zu interessieren. Als Jugendlicher entdeckte ich: Musik ist eine universelle Sprache. Mit Musik lässt sich jedes Gefühl transportieren und verarbeiten. Und die Musik bot plötzlich auch eine Perspektive. Ich sagte mir: "Okay, in diese Richtung willst du arbeiten und Geld verdienen“. Nur in welcher Form das gehen sollte, war noch nicht klar. Irgendwie hatte ich wohl schon immer einen gewissen Spaß daran, anderen Menschen meinen Musikgeschmack aufzudrängen. Deshalb fiel die Entscheidung nicht schwer, als die Frage aufkam, wofür ich mein Geld der Jugendweihe ausgeben will: Mofa oder Plattenspieler?
Die ersten Partys im Jugendclub fanden statt - so lief das mit dem Techno: eine Anlage hinstellen und laut Musik machen. Dann setzte eine Zeit ein, die es bestimmt auch an anderen Orten gab, aber sicher fühlte sie sich nirgends so an, wie in Berlin.
Freiheitsschlag: Techno in (Ost-)Deutschland
"Für viele andere, auch international, ist das bis heute noch ein Thema: der Mauerfall, meine DDR-Vergangenheit und diese Musik. Das spielt alles zusammen."
Die Schönheit des Ost-Deutschen
Zum AnfangDer Autor
Der Autor
Mein Ostdeutschsein
Essay Mein Ostdeutschsein von Ines Geipel
Essay Mein Ostdeutschsein von Ines Geipel

Der Westen wollte den Osten nicht. Er war vollständig, die Revolution unnötig. Noch dazu war man sich über die Zeit hin zum stabilen Feindbild geworden. Wozu daran rütteln? Es stand doch fest, schien auf ewig gemacht. Schon deshalb hört sich das Dauerlamento von der Kolonisierung, den Abgehängten, der Übernahme des Ostens, das mittlerweile zum Kern einer neuen Identitätsschule Ost geworden ist, in mir sturzfalsch an. Es ist ein Konstrukt, eine bequeme Denkblase und stellt die Verhältnisse auf den Kopf.
Meine einschneidendsten Erfahrungen haben mit dem Osten zu tun
"Wir hocken mitten in der Geschichte, es kommt schnell zu Missverständnissen" - Ines Geipel
"Wir hocken mitten in der Geschichte, es kommt schnell zu Missverständnissen" - Ines Geipel

Meine einschneidendsten Erfahrungen haben mit dem Osten zu tun
Ein schwarzes Loch
"Ohne Frage sind wir heute alle in einer eigenen inneren Baggerlandschaft unterwegs"- Ines Geipel
Luftaufnahmen des Cospudener Tagebaus bei Leipzig 1990. Heute befindet sich an dieser Stelle das Naherholungsgebiet Cospudener See.
"Wir richten uns ein, mit grassierendem Rassismus im Osten, mit rechter Gewalt, mit Neid und Hass, als sei all das da wie das Wetter." - Ines Geipel
"Wir richten uns ein, mit grassierendem Rassismus im Osten, mit rechter Gewalt, mit Neid und Hass, als sei all das da wie das Wetter." - Ines Geipel

Friedensnobelpreis für die Ostdeutschen
Friedensnobelpreis für die Ostdeutschen
Friedensnobelpreis für die Ostdeutschen

Friedensnobelpreis für die Ostdeutschen
Mein Ostdeutschsein will, dass daraus so etwas wie Gewissheit und Stolz entsteht. Dass es uns gelingt, unsere so mürbe machenden destruktiven Kraftfelder zu überwinden. Dass wir den Opfern der ostdeutschen Diktatur endlich die Hand reichen. Dass auch die in Ostdeutschland zu Hause sind, die erst 1993 in Spanien oder etwa 2002 in Marokko geboren wurden. Sie sollen sich nicht abgewiesen fühlen müssen, weil sie in Leipzig oder wo auch immer im Osten zu hören bekommen, ihr Kommen sei eine Art kultureller Aneignung.
Schön, dass ihr da seid!
//
Die Autorin
Die Autorin
"Bin ich wirklich Ostdeutsch"
Bin ich wirklich Ostdeutsch? von Sven Gabor Janszky
Bin ich wirklich Ostdeutsch? von Sven Gabor Janszky

Mein eigenes Bild des Ostdeutsch-Seins passt also so gar nicht zu dem Bild der Medien über die Ostdeutschen. Diesen medientypischen, jammernden Transferempfänger, der lieber nach Führer und Staat ruft, als selbst Verantwortung zu übernehmen, gibt es in meinem persönlichen Bekanntenkreis genau einmal. In Zahlen: ca. 0,5 Prozent. Ich mache jede Wette, dass der durchschnittliche Westdeutsche eine deutlich höhere „Jammer-Ossi“-Quote in seinem westdeutschen Bekanntenkreis hat.
Positiver Größenwahn
"Für mich beginnt meine Ost-Identität im Jahr 1989, als in Leipzig zehntausende Menschen um den Innenstadtring laufen und etwas erreichen, von dem die Regierungen in Washington, Paris und Bonn ganz genau wissen, dass das überhaupt nicht geht."- Sven Gabor Janszky
Video: Montagsdemo in Leipzig. Beitrag "Vom Kirchturm gefilmt" - tagessschau vom 10.Oktober 1989
Komplett die Orientierung verloren
Komplett die Orientierung verloren
Komplett die Orientierung verloren

Mein zweiter Neuanfang war die Wende, in der ich und alle Menschen um mich herum, binnen weniger Monate komplett die Orientierung verloren. Und mein dritter Neuanfang war schließlich selbstgewählt, als ich mit 28 Jahren sowohl meinen Job, als auch mein komplettes bisheriges Leben „kündigte“, weil ich glaubte, dass die Welt noch mehr für mich zu bieten haben müsste.
Viele meiner ostdeutschen Freunde kennen diese Neuanfänge aus eigener Erfahrung. Und sie alle wissen, dass das Leben nach jedem Neuanfang ein Besseres wird. Es sind die Progressiven und Entschlossenen meiner Generation, die inzwischen vielerorts an Schlüsselstellen der deutschen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sitzen. Wer so tiefgreifende Neuanfänge erfolgreich gemeistert hat, den prägt eine gewisse Angstlosigkeit. Inmitten all der heutigen Angstmacherei in Politik und Medien ist das interessant. Denn meine Generation Ostdeutscher hat keine Angst. Weder vor den Russen, noch vor den Chinesen, und auch nicht vor Corona.
Ich gehöre zur letzten Generation, die den Sozialismus wirklich noch erlebt hat. Vermutlich werde ich irgendwann auch einer der letzten sein, die verstehen können, warum meine Großeltern nach dem Krieg diesen sozialistischen Traum aufgebaut haben – den Traum von einer gerechteren Welt als dem Kapitalismus. Ich habe Hochachtung vor meinen Großeltern für ihren Traum und für ihren Aufbauversuch. Und dennoch habe ich persönlich genug von Ideologien. Ich trete nie wieder in eine Partei ein. Ich stelle nie wieder meinen Namen in den Dienst einer Ideologie oder Partei. Und ich werde nie wieder einen Menschen aus ideologischen Gründen verdammen, nicht die Russen, nicht die Chinesen, nicht Pegida-Anhänger oder AfD-Demonstranten.
Aufgewachsen in einem Land, in dem Wahlen nichts geändert haben
Aufgewachsen in einem Land, in dem Wahlen nichts geändert haben
Aufgewachsen in einem Land, in dem Wahlen nichts geändert haben



Der Autor
Der Autor
Mit seiner Frau und drei Kindern lebt er heute in einem kleinen Dorf zwischen Berlin und Leipzig und war früher einmal Vize-Jugend-Mannschafts-DDR-Meister im Schach.
Meine Lebenswende
Essay Meine Lebenswende von Patrice G. Poutrus
Essay Meine Lebenswende von Patrice G. Poutrus

Mit 18 Jahren wurde ich Mitglied der SED und diente von 1981 bis 1984 als Unteroffizier der NVA. Während der Militärzeit gründete ich mit meiner Jugendliebe eine Familie. Wir wurden sehr bald Eltern von zwei Söhnen und erhielten vom fürsorglichen Staat relativ zügig eine Wohnung. Meine Frau studierte an der Humboldt-Universität und wurde Lehrerin, ich hauptamtlicher Funktionär der FDJ, zuerst in meinem Ausbildungsbetrieb, dem VEB Werk für Fernsehelektronik und dann in der Berliner Bezirksleitung der FDJ.
Spätestens seit dem Militärdienst entstand bei mir aber auch die Vorstellung, dass eine verbesserte, reformierte und schließlich demokratische DDR auf die Dauer eine derart bedrohliche Grenze nicht mehr brauchen würde. Aus vielerlei Gründen endeten meine Bemühungen um eine bessere DDR in trügerischen Versuchen als Jungendfunktionär „Schlimmeres zu verhüten“ und dabei möglichst anständig zu bleiben. Ob mir das gelang, mag und kann ich nicht zweifelsfrei beurteilen. Schon deshalb nicht, weil ich bis heute die möglichen Folgen meines Tuns als junger Kader des SED-Staates nicht vollends übersehen kann und mein vermehrtes Wissen über die DDR-Geschichte diese Zweifel nicht ruhen lässt.
Das Jahr 1989 war für mich in mehrfacher Hinsicht eine schwere Enttäuschung. Durch die gefälschten Kommunalwahlen und die öffentliche Zustimmung der SED zum Massaker auf dem Tianʼanmen-Platz in Peking wurde unübersehbar, dass mit der Führung des SED-Staates keine der überfälligen Reformen erreichbar waren. Mit der stetig anwachsenden Ausreisebewegung in die Bundesrepublik und den sich steigernden Massenprotesten wurde mir allmählich klar, dass es mit der Partei- und Staatsführung der DDR keinen reformierten Sozialismus geben konnte. Schließlich offenbarte die lange geforderte und dann überraschend vollzogene Öffnung der Grenzen am 9. November 1989, dass der SED-Staat keinerlei Souveränitätspotenziale mehr besaß.
Bittere Lektion
"Ich gehörte nicht zu den Siegern der Geschichte, wie ich es noch in der Schule, beim Militär und in der SED gelernt hatte" - Patrice Poutrus
"Ich gehörte nicht zu den Siegern der Geschichte, wie ich es noch in der Schule, beim Militär und in der SED gelernt hatte" - Patrice Poutrus

Bittere Lektion
Es brauchte einige Zeit, bis ich sie annehmen konnte. Irgendwann am Anfang der 1990er Jahre verließ ich die SED, die ihren Namen inzwischen mehrfach gewechselt hatte. Im Winter 1989/90 begann ich wieder in meinem alten Ausbildungsbetrieb zu arbeiten. Wahrscheinlich hätte ich diese Arbeit, wie viele tausende andere Ostberliner, bald verloren. Aber bevor es dazu kam, begann ich 1990, mit 29 Jahren, Geschichte und Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu studieren, denn mit dem Ende des SED-Staates waren die früheren Zulassungsbeschränkungen aufgehoben und so schien der Weg für einen Neuanfang frei.
Was folgte waren fünf Jahre wirklich tiefgreifender Veränderungen für mich und ebenso für meine Familie, die wir nicht ohne Furcht, Schmerz und Verlust überstanden haben, aber wir sind letztlich doch gut durch diese schwierige Zeit gekommen. Aus all dem Erzählten wird hoffentlich auch deutlich, dass für mich nicht die Deutsche Einheit, sondern in erster Linie der Herbst 1989 der zentrale Einschnitt in meinem Leben war.
Zwischen „Wir sind das Volk!“-Rufen ein Schild: „Ich bin Volker“
Zwischen „Wir sind das Volk!“-Rufen ein Schild: „Ich bin Volker“
tagesschau vom 4. November 1989
Die Verhältnisse waren, sind und bleiben kompliziert
Zum AnfangDer Autor
Der Autor
Essay Ossis, seid wütend! von Josa Mania-Schlegel
Essay Ossis, seid wütend! von Josa Mania-Schlegel

Vor einer Weile spürte ich die Wut wieder. Ich saß in einer Leipziger Kneipe und beobachtete wie die Kellnerin hinter dem Tresen immer wieder neue Biere und Schnäpse einschenkte. Sie stellte sie den etwa gleichaltrigen Jungs auf der anderen Seite hin.
Es war nicht die Szene an sich, die mich wütend machte. Es hat ja etwas Harmonisches, wie sich Schnaps- und Biergläser immer wieder leeren und füllen. Wütend machte mich, dass es hier wieder einmal eine junge Ostdeutsche war, die arbeitete. Und es junge Westdeutsche waren, die Geld ausgaben.
Seltsamerweise wird über diese Ungleichheit wenig gesprochen
Zum AnfangJeder fünfte Erbe einer westdeutschen Familie startet mit 100.000 Euro in sein Leben
Zum AnfangIch bin nicht wütend auf die Westdeutschen. Was können sie schon dafür, in eine heile Welt hineingeboren zu sein?
Ich bin nicht wütend auf die Westdeutschen. Was können sie schon dafür, in eine heile Welt hineingeboren zu sein?
Ich bin nicht wütend auf die Westdeutschen. Was können sie schon dafür, in eine heile Welt hineingeboren zu sein?

Nein, ich bin nicht wütend auf die Westdeutschen. Was können sie schon dafür, in eine heile Welt hineingeboren zu sein? Wütend macht mich die Teilnahmslosigkeit der Nachwendegeneration. Wir Ostdeutschen sind seltsam still, wenn es um diese ungleiche Verteilung geht. Das merkt man an der Euphorie, die losbricht, wenn man doch einmal darauf hinweist.
Vor einer Weile tat ich das. Ich beschrieb, auf Twitter, die Kneipenszene vom Anfang des Textes. Ich bin dort seit zehn Jahren aktiv, aber so viele Reaktionen bekam ich noch nie. Die Like und Herzen kamen fast alle von Ostdeutschen. Westdeutsche Accounts reagierten wütend, einer schrieb, ich sei „undankbar“. Und meine Freunde, die noch nie im Osten waren, schickten mir Nachrichten, ob ich ihnen den für sie rätselhaften Tweet einmal erklären könne.
Neulich twitterte jemand anderes: „Westdeutsche Studentin in Leipzig versteht das Problem Einheimischer mit Gentrifizierung nicht, weil ‚es ist doch spottbillig, deswegen bin ich ja hergekommen‘, wird aber von Vati gesponsert.“
Es sind nur zwei Tweets, mit einem Abstand von Monaten. Aber manchmal wird genau so eine kleine Welle losgetreten. Dann hätte die Utopie eine Chance. //
Der Autor
Der Autor
Essay Ost schon - deutsch nicht von Sookee
Essay Ost schon - deutsch nicht von Sookee

1986 wurde dann endlich ein Ausreiseantrag bewilligt und es gab ein Zeitfenster, innerhalb von 24 Stunden das Land zu verlassen. Wäre uns das nicht geglückt, hätte wieder eine Inhaftierung gedroht, denn vor der Ausreise wurde meinen Eltern die Staatsangehörigkeit entzogen. Sie wären auf realsozialistischem Boden staatenlos gewesen. Die Konsequenz daraus: Inhaftierung.
Aber meine Eltern haben es geschafft. Die ersten Monate nach der Übersiedlung verbrachten wir in einem Notaufnahmelager in West-Berlin. Ich, damals zweijährig, durchlebte meine ersten Kindheitserinnerungen, während meine Eltern gegenüber den Alliierten-Behörden glaubhaft vermitteln mussten, dass sie keine Spionagetätigkeit beabsichtigten.
Als Grundschülerin waren Gauck und Mielke vertraute Namen, während Gleichaltrige eher wussten wer die Kelly Family und Michael Jackson waren. Ich lachte über Wortverdreher wie Stasel-Spitzi und Zuschreibungen wie Besserwessi. Bis heute vergeht keine Begegnung mit meinem inzwischen 71-Jährigen Vater, ohne dass die SED-Diktatur thematisiert wird.
Auch meine Mutter hat sich einen gesunden Mangel an Obrigkeitshörigkeit behalten, der sie als 14-Jährige dazu brachte aus der FDJ auszutreten und drei Jahre später die Biermann-Resolution zu unterschreiben. Bis heute fühlt sie den satten, durchindividualisierten Westen, den sie kennenlernte, als sich der Kapitalismus jenseits der Mauer um sie herum auftürmte.
Kein Pionierhalstuch, aber Baggy Pants.
"Es ist nicht leicht, das verständlich zu machen, aber ich bin latent traurig darüber, dass die DDR es so dermaßen verkackt hat." -Sookee
"Es ist nicht leicht, das verständlich zu machen, aber ich bin latent traurig darüber, dass die DDR es so dermaßen verkackt hat." -Sookee

Aber Teile der Erfahrungen meiner Eltern leben in mir weiter. Zwar nicht das Misstrauen gegenüber meinen Nächsten als Konsequenz aus der Überwachung durch die Staatssicherheit und der Schmerz des Verrats durch Kolleg*innen und Familienangehörige. Aber die Enttäuschung über die autoritäre Form des Realsozialismus im trotz allem immer noch sozialistischen Herz wiegt schwer.
Es ist nicht leicht, das verständlich zu machen, aber ich bin latent traurig darüber, dass die DDR es so dermaßen verkackt hat. Die große Idee von der Gleichheit der Menschen, von Emanzipation, Freiheit und Solidarität, die Herauslösung aus Armut und Unterdrückung, die Überwindung des Kapitalismus so grundlegend zu verraten - das muss eine Gesellschaft erst einmal schaffen. Ein weiteres Beispiel dafür zu werden, dass Aufrichtigkeit und gerechte Verteilung als funktionierende Prinzipien dem Menschen nicht möglich ist. Dass einige sich - große Reden schwingend - an den anderen bereichern. Dass sie lügen, diffamieren und autoritär ausgrenzen, töten sogar. Und das alles unmittelbar nach der Erfahrung des Holocaust.
Rassismus-Problem im Osten zur eigenen Imagepflege
"Der dumme Ossi. Früher war er Bauer, im VEB und im Kopf, heute ist er arbeitslos und Nazi. Haha." - Sookee
"Der dumme Ossi. Früher war er Bauer, im VEB und im Kopf, heute ist er arbeitslos und Nazi. Haha." - Sookee

Rassismus-Problem im Osten zur eigenen Imagepflege
Natürlich hat das wiedervereinigte Deutschland von Bonn aus nichts dagegen getan außer christlich anmutend eine Lichterkette zu bilden. Für eine tatsächliche Bekämpfung dieser Situation hätte sich der Westen ja mit seinem eigenen Nationalismus auseinandersetzen müssen. Insofern ist der 3. Oktober auch für mich kein Grund zum Feiern. Die deutsche Einheit ist vor dem Hintergund von Rostock-Lichtenhagen über NSU bis Hanau für mich eher ein Schreckensszenario, kein Ort, an dem ich gelebte Demokratie lieben lernte.
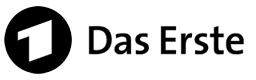























































 Ostdeutsch sein. Was heißt das?
Ostdeutsch sein. Was heißt das?
 Vorwort
Vorwort
 "Letzte Generation Ost"
"Letzte Generation Ost"
 "Ostdeutsch sein: Zwischen Zusammenhalt und Perspektivlosigkeit"
"Ostdeutsch sein: Zwischen Zusammenhalt und Perspektivlosigkeit"
 "Mein Ostdeutschsein"
"Mein Ostdeutschsein"
 "Bin ich wirklich ostdeutsch?"
"Bin ich wirklich ostdeutsch?"
 "Meine Lebenswende"
"Meine Lebenswende"
 "Ossis, seid wütend!"
"Ossis, seid wütend!"
 "Ost schon, deutsch nicht"
"Ost schon, deutsch nicht"
 "Gibt es eine einheitliche Erzählung nach der Friedlichen Revolution? Kann es sie geben?"
"Gibt es eine einheitliche Erzählung nach der Friedlichen Revolution? Kann es sie geben?"
 Prägt uns die Ost-DNA heute noch?
Prägt uns die Ost-DNA heute noch?
 "Wir haben etwas zu erzählen, das andere so nicht erzählen können"
"Wir haben etwas zu erzählen, das andere so nicht erzählen können"
 "Dann setzte eine Zeit ein, die es bestimmt auch an anderen Orten gab, aber sicher fühlte sie sich nirgends so an, wie in Berlin"
"Dann setzte eine Zeit ein, die es bestimmt auch an anderen Orten gab, aber sicher fühlte sie sich nirgends so an, wie in Berlin"
 "Für viele andere, auch international, ist das bis heute noch ein Thema: der Mauerfall, meine DDR-Vergangenheit und diese Musik. Das spielt alles zusammen."
"Für viele andere, auch international, ist das bis heute noch ein Thema: der Mauerfall, meine DDR-Vergangenheit und diese Musik. Das spielt alles zusammen."
 Freiheitsschlag: Techno in (Ost-)Deutschland
Freiheitsschlag: Techno in (Ost-)Deutschland
 Die Schönheit des Ostdeutschen
Die Schönheit des Ostdeutschen
 "Wir hocken mitten in der Geschichte, es kommt schnell zu Missverständnissen"
"Wir hocken mitten in der Geschichte, es kommt schnell zu Missverständnissen"
 "Ohne Frage sind wir heute alle in einer eigenen inneren Baggerlandschaft unterwegs"
"Ohne Frage sind wir heute alle in einer eigenen inneren Baggerlandschaft unterwegs"
 "Wir richten uns ein, mit grassierendem Rassismus im Osten, mit rechter Gewalt, mit Neid und Hass, als sei all das da wie das Wetter."
"Wir richten uns ein, mit grassierendem Rassismus im Osten, mit rechter Gewalt, mit Neid und Hass, als sei all das da wie das Wetter."
 Friedensnobelpreis für die Ostdeutschen
Friedensnobelpreis für die Ostdeutschen
 Positiver Größenwahn
Positiver Größenwahn
 Komplett die Orientierung verloren
Komplett die Orientierung verloren
 Aufgewachsen in einem Land, in dem Wahlen nichts geändert haben
Aufgewachsen in einem Land, in dem Wahlen nichts geändert haben
 Der Autor
Der Autor
 "Ich gehörte nicht zu den Siegern der Geschichte, wie ich es noch in der Schule, beim Militär und in der SED gelernt hatte"
"Ich gehörte nicht zu den Siegern der Geschichte, wie ich es noch in der Schule, beim Militär und in der SED gelernt hatte"
 Zwischen „Wir sind das Volk!“-Rufen ein Schild: „Ich bin Volker“
Zwischen „Wir sind das Volk!“-Rufen ein Schild: „Ich bin Volker“
 Verschiedenheiten sind kein Makel
Verschiedenheiten sind kein Makel
 Die Verhältnisse waren, sind und bleiben kompliziert
Die Verhältnisse waren, sind und bleiben kompliziert
 Ossis, seid wütend!
Ossis, seid wütend!
 Seltsamerweise wird über diese Ungleichheit wenig gesprochen
Seltsamerweise wird über diese Ungleichheit wenig gesprochen
 Jeder fünfte Erbe einer westdeutschen Familie startet mit 100.000 Euro in sein Leben
Jeder fünfte Erbe einer westdeutschen Familie startet mit 100.000 Euro in sein Leben
 "Es ist nicht leicht, das verständlich zu machen, aber ich bin latent traurig darüber, dass die DDR es so dermaßen verkackt hat."
"Es ist nicht leicht, das verständlich zu machen, aber ich bin latent traurig darüber, dass die DDR es so dermaßen verkackt hat."
 "Der dumme Ossi. Früher war er Bauer, im VEB und im Kopf, heute ist er arbeitslos und Nazi. Haha."
"Der dumme Ossi. Früher war er Bauer, im VEB und im Kopf, heute ist er arbeitslos und Nazi. Haha."
 Ost schon - deutsch nicht
Ost schon - deutsch nicht
 Sookee - Q1
Sookee - Q1